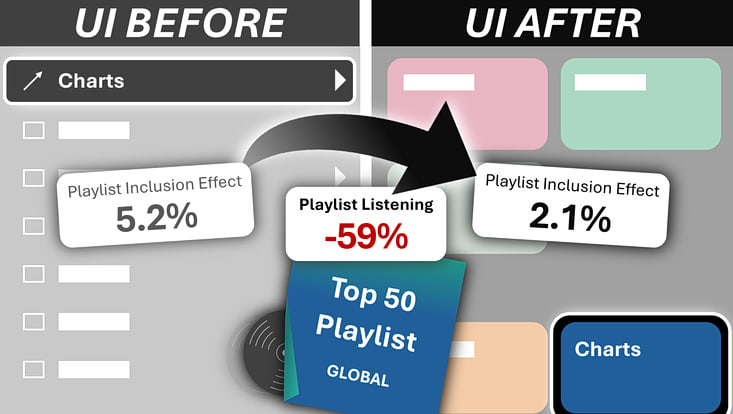Dr. Johanna LorenzPostdoc Forschungsaufenthalt in Groningen
5. Mai 2025

Foto: privat
Dr. Johanna Lorenz, Postdoktorandin im Bereich Wirtschaftsinformatik an der Nucleus-Professur für Information Systems and Digital Innovation (Prof. Dr. Jan Recker) sowie der Professur für Marketing and Branding (Prof. Dr. Henrik Sattler) berichtet über ihren Forschungsaufenthalt bei Prof. Dr. Ulrike Schultze (Professorin im Bereich Information Systems) an der Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in den Niederlanden.
Dr. Johanna Lorenz ist Postdoktorandin im Bereich Wirtschaftsinformatik an der Nucleus-Professur für Information Systems and Digital Innovation (Prof. Dr. Jan Recker) sowie der Professur für Marketing and Branding (Prof. Dr. Henrik Sattler). Im März 2025 absolvierte sie einen einwöchigen Forschungsaufenthalt bei Prof. Dr. Ulrike Schultze (Professorin im Bereich Information Systems) an der Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in den Niederlanden. Im Gespräch berichtet sie von ihren Eindrücken und dem geplanten Forschungsprojekt.
Frau Lorenz, was führte Sie nach Groningen?
Ich war für eine Woche an der Rijksuniversiteit Groningen zu Gast, um gemeinsam mit Prof. Dr. Ulrike Schultze ein neues empirisches Forschungsprojekt zu konzipieren. Wir haben thematisch große Überschneidungen in den Forschungsinteressen und konnten durch den persönlichen Austausch vor Ort eine solide Basis für die gemeinsame Zusammenarbeit schaffen. Außerdem finde ich es enorm spannend, über den Tellerrand zu schauen und zu erleben, wie andere Universitätssysteme im Ausland funktionieren.
Worum geht es in Ihrem geplanten Projekt?
Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie digitale Technologien, die direkt am oder sogar im Körper getragen werden, unsere persönliche Identität beeinflussen. Dazu gehören etwa Fitness-Tracker, Smartwatches, implantierte Chips oder medizinische Geräte wie Smart Implants. Solche Technologien begleiten uns heute nicht mehr nur im Hintergrund – sie sind eng mit unserem Körper verbunden und beeinflussen potenziell, wie wir uns selbst wahrnehmen und darstellen. In gewisser Weise rücken wir damit näher an die Vorstellung eines „Cyborgs“ heran - eines Wesens, das biologische (also körperliche) und technologische (technisch-elektronische) Elemente miteinander verbindet. Wir möchten empirisch untersuchen, wie verschiedene Arten der Nutzung dieser Technologien auf unterschiedliche Weise die persönliche Identität beeinflussen – sei es durch Praktiken zur Selbstüberwachung von Fitness oder Gesundheit (zum Beispiel mit Wearables oder Fitness-Trackern), durch Veränderungen am Körper als künstlerischer oder symbolischer Ausdruck (etwa in der sogenannten Bodyhacking-Community, in der sich Menschen Chips oder Antennen ohne primär funktionalen Zweck implantieren lassen), oder durch Praktiken zum funktionalen Enhancement (wie intelligente Implantate zur Wiederherstellung von Organfunktionen, beispielsweise künstliche Bauchspeicheldrüsen). Dieses neue Zusammenspiel von Körper und Technik wirft daher die Frage auf, wie sich persönliche Identität im digitalen Zeitalter möglicherweise verändert.
Wie war der Austausch vor Ort?
Sehr produktiv, inspirierend und motivierend – es hat unglaublich viel Freude gemacht, eine Idee in den täglichen Brainstorming-Sessions weiterzuentwickeln und mitzuerleben, wie sie nach und nach Gestalt annahm. Von Prof. Dr. Schultze, die zahlreiche Schlüsselpublikationen unter anderem zu den Themen „Digital Embodiment“ und „Personal Identity“ im Bereich Information Systems verfasst hat, kann ich sowohl methodisch als auch theoretisch sehr viel lernen. Besonders bereichernd war auch der offene und herzliche Austausch mit Kolleginnen und Kollegen vor Ort an der Fakultät.
Hatten Sie auch Zeit, Groningen zu erkunden?
Ja, Groningen ist eine lebendige Stadt, die durch die vielen Studierenden jung und international wirkt. Gleichzeitig ist sie richtig idyllisch – genau so, wie man sich eine niederländische Stadt mit vielen Kanälen, Tulpen, alten Häusern, netten Cafés und unzähligen Fahrrädern vorstellt.
Haben Sie Tipps für andere Postdocs oder Doktorand:innen, die einen kurzen Forschungsaufenthalt planen?
Oft sind kurze Forschungsaufenthalte unkompliziert zu organisieren und können dennoch sehr viel bewirken. Wichtig ist es, realistische Ziele zu setzen und gleichzeitig offen für neue Impulse zu bleiben. Ich war selbst überrascht, wie weit eine Idee reifen kann, wenn man während des Aufenthalts den Fokus auf einen intensiven Austausch legt. Hilfreich fand ich auch, gemeinsam einen Antrag auf Forschungsförderung (z. B. im Rahmen des Hamburg-Groningen Funding Programms) zu konzipieren – das macht es notwendig, sich mit allen Facetten des Projekts auseinanderzusetzen (z. B. Zeitplan, Forschungsfragen, Methodik und Forschungsdesign). So kann man die Projektkonzeption in einen schriftlichen Rahmen gießen – und durch das Schreiben wird vieles klarer.
Vielen Dank für das Gespräch!